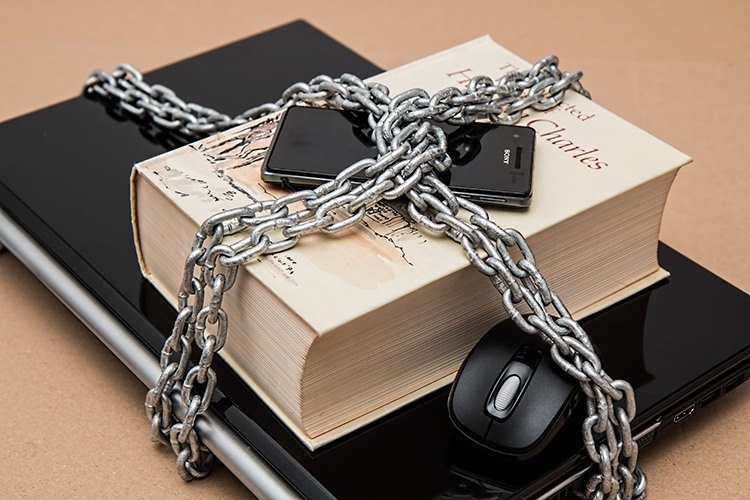Es ist nicht immer MFA, wenn MFA draufsteht.
Am 27. August wurde die Firma Retool, der Anbieter einer Low-Code-Entwicklungsplattform, Opfer eines Social-Engineering-Angriffs. Dank der im April eingeführten Synchronisationsfunktion der Google-Authenticator-App konnten Angreifer die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zu einer Single-Faktor-Authentifizierung downgraden und sich so Zugriff zum Retool-Netzwerk verschaffen.
Der initiale Eindringvektor der Angreifer war ein Smishing-Angriff (Phishing über SMS-Textnachrichten) an mehrere Retool-Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter ist dem Aufruf der Nachricht gefolgt und hat seine Zugangsdaten auf einem gefälschten Log-in-Portal eingegeben. Da Retool MFA verwendet, erhielten die Angreifer mit den Zugangsdaten allein jedoch noch keinen Zugriff zu den Accounts oder dem Retool-Netzwerk. Daher starteten sie einen gut vorbereiteten Vishing-Anruf (Phishing über Telefon) gegen den Mitarbeiter und konnten diesem auch einen Code für die Multi-Faktor-Authentifizierung entlocken.
Die Angreifer verwendeten die Zugangsdaten und den MFA-Code, um ihr Gerät mit dem SSO-Konto des Mitarbeiters zu verbinden und u. a. Zugriff zu seinem Google-Konto zu erhalten. Dies erwies sich als verheerend, da Google seine in der Google-Authenticator-App generierten MFA-Codes seit April 2023 automatisch mit dem Google-Konto synchronisiert. Die Angreifer konnten nun die MFA-Codes, welche z. B. bei der Verbindung mit dem Retool-VPN oder den Verwaltungssystemen benötigt wurden, einfach aus dem Google-Konto des kompromittierten Mitarbeiters auslesen. Effektiv wurde die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) dadurch zu einer Single-Faktor-Authentifizierung herabgestuft.
Unternehmen, welche auf die Google-Authenticator-App setzen, sollten sich bewusst sein, dass die Synchronisationsfunktion standardmäßig aktiv ist. Das Deaktivieren der Funktion ist nur möglich, indem das Google-Konto vollständig von der App entkoppelt wird.
Immer wieder überrascht die Kreativität der Angreifer, mit welcher versucht wird, MFA zu umgehen. Seit Jahren werden bspw. SIM-Swapping-Angriffe dazu genutzt, um über SMS versendete MFA-Codes abzufangen.
Mittels sogenannten MFA-Bombing- oder MFA-Fatigue-Angriffen ist es der Hackergruppe „Lapsus$“ Anfang 2022 gelungen, die MFA von Microsoft und anderen Unternehmen zu umgehen. Bei diesem Angriff werden die betroffene Personen mit MFA-Anfragen überflutet, z. B. um 1 Uhr nachts, in der Hoffnung, dass sie in der Stress-Situation oder versehentlich eine davon akzeptieren.
Einen Phishing-resistenteren MFA-Schutz bieten Sticks oder Android-Smartphones mit Fido bzw. WebAuthn. Der Nachteil dieser Lösung ist, dass der zu schützende Dienst diese unterstützen muss.
https://retool.com/blog/mfa-isnt-mfa/
https://security.googleblog.com/2023/04/google-authenticator-now-supports.html
https://www.golem.de/news/lapsus-hackergruppe-umgeht-2fa-mit-einfachem-trick-2203-164236.html